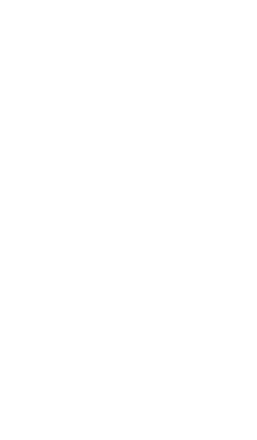Balljunkie
Was bedeutet es, wenn ein Hund ein Balljunkie ist?
Als „Balljunkie“ bezeichnet man Hunde, die eine übermäßige Fixierung auf ein bestimmtes Spielzeug entwickelt haben, häufig einen Ball, aber auch andere Gegenstände wie Frisbees können betroffen sein. Der Begriff „süchtig“ ist in diesem Zusammenhang durchaus gerechtfertigt: Die Verhaltensweisen dieser Hunde ähneln stark denen menschlicher Suchterkrankungen, einschließlich körperlicher und psychischer Entzugserscheinungen.
Ist das begehrte Spielzeug in Sicht oder vermutet der Hund nur dessen Anwesenheit, kann er sich kaum noch auf andere Reize einlassen. Normale Hundeverhaltensweisen wie Spielen mit Artgenossen, Schnüffeln oder das Erkunden der Umgebung treten in den Hintergrund. Stattdessen beobachtet der Hund angespannt seinen Menschen, bellt möglicherweise, legt das Spielzeug wiederholt vor die Füße oder blockiert den Weg, alles mit dem Ziel, das Spiel zu initiieren. In besonders ausgeprägten Fällen fixieren sich Hunde sogar auf Staub oder kleine Steinchen, die zufällig beim Laufen aufgewirbelt werden.
Was aus menschlicher Sicht wie ein spielerischer Zustand wirkt, ist für den Hund in Wahrheit oft eine stressbeladene Situation. Viele zeigen eine hohe innere Anspannung: Sie starren auf Taschen, in denen sich das Spielzeug befinden könnte, ignorieren ihre Umwelt und laufen sogar gegen Hindernisse, ganz auf das nächste Spiel fokussiert. Kurzzeitiger Stress ist in Ordnung, aber eine derartige dauerhafte Anspannung, etwa bei jedem Spaziergang, stellt eine erhebliche Belastung dar.
Hinzu kommt, dass der Hund seine natürlichen Bedürfnisse vernachlässigt: Er schnüffelt kaum noch, spielt nicht mit Artgenossen und bewegt sich nicht frei, sondern steht permanent unter innerer Spannung. Das kann auf Dauer krank machen, nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Durch das ständige Abstoppen und ruckartige Bewegungen beim Ballspiel werden insbesondere Gelenke stark belastet. Vor allem Hunde mit genetischer oder gesundheitlicher Vorbelastung riskieren so frühzeitige Schäden wie Arthrosen. Manche Hunde sind durch intensives Ballspiel regelrecht „kaputtgespielt“.
Aus menschlicher Sicht erscheint dieser Zustand oft vorteilhaft: Der Hund lässt sich scheinbar problemlos lenken, ist jederzeit abrufbar, lässt sich durch das Spielzeug aus kritischen Situationen lotsen. Doch diese Steuerung basiert nicht auf echter Bindung oder Gehorsam, der Mensch übernimmt vielmehr unbewusst die Rolle eines „Dealers“, der das Suchtmittel liefert.
Betroffen sind meist temperamentvolle, spielfreudige Hunde, insbesondere Rassen aus dem Arbeitsbereich, wie Hüte- oder Schäferhunde. Der Einstieg in die Sucht verläuft schleichend: Anfangs freut man sich über die Spielfreude des Hundes, der begeistert apportiert. Gerade bei sehr aktiven Hunden scheint das Ballspiel ein ideales Mittel zur Auslastung zu sein. Doch irgendwann reicht selbst eine Stunde Ballwerfen nicht mehr aus, der Hund fordert unermüdlich weiter, ist äußerlich vielleicht muskulös, aber innerlich dauerhaft gestresst und weit entfernt von innerer Balance.
Was kann man tun, um einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken?
Wer Anzeichen erkennt, dass der eigene Hund eine zu starke Fixierung auf ein Spielzeug entwickelt, sollte klare Regeln etablieren. Wichtig ist: Der Hund entscheidet nie, wann gespielt wird, das liegt ausschließlich in der Verantwortung des Menschen. Das Spielzeug kann als besondere Belohnung für gutes Verhalten eingesetzt werden, sollte aber nicht unkontrolliert verfügbar sein.
Ein Beispiel: Ein altdeutscher Schäferhund aus Arbeitslinie, mit hoher Veranlagung zum Balljunkie, erhält sein Spielzeug maximal zwei- bis dreimal täglich. Dabei wird es selten einfach geworfen, meist geht eine kleine Übung voraus. Ein klares Signal (wie „Fertig“) zeigt an, dass das Spiel beendet ist. Auch bei forderndem Verhalten wird nicht nachgegeben. In besonders herausfordernden Situationen, etwa beim zuverlässigen Abruf in wildreichen Gebieten, kann das Spielzeug als gezielte Belohnung eingesetzt werden. Dabei gilt die Regel: Belohnung nach erwünschtem Verhalten, nicht Bestechung im Vorfeld.
Wenn der Hund bereits stark fixiert ist: Der „kalte Entzug“
Ist die Fixierung bereits sehr stark ausgeprägt, hilft häufig nur ein konsequenter Verzicht auf das Spielzeug, zumindest für eine gewisse Zeit. In leichten Fällen kann es noch mitgeführt, aber nicht eingesetzt werden. Ignoriert der Hund jedoch alle Umweltreize und konzentriert sich ausschließlich auf das Spielzeug, sollte dieses auch nicht mehr mitgeführt werden. Geduld ist in dieser Phase besonders wichtig.
Parallel dazu sollte dem Hund eine alternative, artgerechte Auslastung angeboten werden. Fährtenarbeit oder Mantrailing orientieren sich eng am natürlichen Jagdverhalten des Hundes und sind für viele Tiere äußerst befriedigend. Auch sorgfältig aufgebautes Dummytraining stellt eine sinnvolle Alternative dar.
Wenn der Hund wieder in der Lage ist, Spaziergänge ausgeglichen zu erleben, können Spielzeuge kontrolliert und gezielt als Belohnung eingesetzt werden. Das Werfen sollte dabei die Ausnahme bleiben, besser ist es, das Spielzeug suchen zu lassen oder in Übungen einzubauen. Ziel ist es, Spiel nicht zu verbieten, sondern bewusst und sinnvoll zu integrieren.